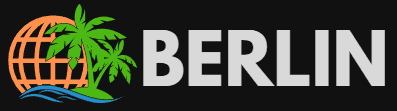Immer neue Fragen rund um ein Medikament aus Berlin: Mehr als 400 Verdachtsfälle, jahrzehntelanges Schweigen, politische Kritik – die Geschichte von Duogynon sorgt weiter für Schlagzeilen.
Inhaltsverzeichnis:
- Thea Hermann und die Folgen von Duogynon
- Einsatzgebiet und Wirkmechanismus von Duogynon
- Reaktionen der Behörden und unterlassene Maßnahmen
- Bayer lehnt Verantwortung ab – Gutachten sorgen für Kritik
- Großbritannien entschuldigt sich – Deutschland zögert
Thea Hermann und die Folgen von Duogynon
Duogynon, ein von der Berliner Schering AG zwischen 1950 und 1981 vertriebenes Hormonpräparat, steht weiterhin im Verdacht, schwere Fehlbildungen bei Neugeborenen verursacht zu haben. Ein aktuelles Gutachten bringt neue Dynamik in eine Debatte, die seit Jahrzehnten Betroffene, Behörden und den Pharmakonzern Bayer beschäftigt. Zahlreiche Menschen vermuten einen Zusammenhang zwischen dem Medikament und Missbildungen wie Wasserköpfen, Herzfehlern oder deformierten Organen.
Thea Hermann wurde 1960 in Berlin mit einer Fehlbildung des linken Auges geboren. Die Iris war unvollständig, sie kann auf diesem Auge nicht sehen. Bis heute vermutet sie, dass das Medikament Duogynon, das ihre Mutter eingenommen hatte, die Ursache war. Hermann ist kein Einzelfall. Insgesamt liegen dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 405 Meldungen mit ähnlichem Hintergrund vor – davon 44 mit Todesfolge.
Auch André Sommer, ein Grundschullehrer aus Bayern, wurde 1976 mit einer schweren Missbildung geboren. Seine Genitalien waren deformiert, die Blase lag außerhalb des Körpers. Jahrzehntelang blieb die Ursache unklar, bis seine Mutter ihm berichtete, dass sie Duogynon während der Schwangerschaft eingenommen hatte. Sommer gründete daraufhin 2019 das „Netzwerk Duogynon“, um Betroffenen eine Stimme zu geben und Aufklärung zu fordern.
Einsatzgebiet und Wirkmechanismus von Duogynon
Duogynon wurde als Hormonpräparat zur Behandlung von Menstruationsstörungen und als Schwangerschaftstest verwendet. Es enthielt hohe Dosen von Östrogen und Gestagen – deutlich mehr als heutige Antibabypillen. Eine eintretende Blutung nach Einnahme galt als Hinweis auf eine Nicht-Schwangerschaft.
1950: Einführung als Injektionslösung
1957: Markteinführung als Tablettenform
1981: Rückzug vom deutschen Markt
Im Gegensatz zu modernen, biochemisch präzisen Schwangerschaftstests arbeitete Duogynon mit hormonellen Reaktionen. Früh wurde jedoch Kritik laut. Eine Studie in der Zeitschrift „Nature“ von 1967 sprach von einem signifikanten Zusammenhang zwischen der Einnahme und Fehlbildungen. Interne Schering-Gutachten warnten vor möglichen Gefahren.
Reaktionen der Behörden und unterlassene Maßnahmen
In vielen Ländern wie Australien, den Niederlanden oder Schweden wurde Duogynon bereits in den 1970er Jahren verboten. In Deutschland blieb es jedoch weiterhin auf dem Markt, wenn auch mit geänderter Indikation. Warnhinweise gegenüber Ärzten oder der Öffentlichkeit erfolgten nur sehr eingeschränkt.
Erst 1981 wurde das Präparat vom deutschen Markt genommen – rund ein Jahrzehnt nach den ersten internationalen Warnungen. Kritiker wie Medizinhistoriker Tobias Arndt und das Netzwerk Duogynon werfen dem damaligen Bundesgesundheitsamt eine zu große Nähe zur Industrie vor. Recherchen in über 7.000 Seiten Ermittlungsakten belegen, dass ein leitender Beamter sich selbst als „Advokat Scherings“ bezeichnet haben soll.
Bayer lehnt Verantwortung ab – Gutachten sorgen für Kritik
Die heutige Bayer AG, die Schering 2006 übernahm, weist jede Verantwortung zurück. Das Unternehmen beruft sich auf Untersuchungen aus den 1970er und 1980er Jahren, die keinen eindeutigen Kausalzusammenhang feststellen konnten. Auch die Staatsanwaltschaft stellte Ermittlungen wegen fehlender Nachweise ein.
2021 verabschiedete der Bundestag einstimmig eine Petition, die ein offizielles Forschungsprojekt zum Fall Duogynon forderte. 2023 kam ein historisches Gutachten zu dem Schluss, dass den Behörden damals die rechtliche Grundlage für ein Verbot gefehlt habe. André Sommer kritisiert, dass der Autor des Gutachtens diese Einschätzung schon vor der Beauftragung vertreten habe.
Im Oktober 2023 traf sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit Sommer und Arndt. Er versprach ein neues juristisches Gutachten – doch erneut wurde der Auftrag unter der Prämisse vergeben, das bisherige Gutachten als sachliche Grundlage zu verwenden. Die Betroffenen zeigten sich enttäuscht.
Großbritannien entschuldigt sich – Deutschland zögert
In Großbritannien wurde ein vergleichbares Medikament namens „Primodos“ bereits 2019 durch eine unabhängige Kommission untersucht. Rund 700 Betroffene wurden angehört. Der Abschlussbericht stellte Versäumnisse der Behörden fest. In der Folge entschuldigte sich der damalige Gesundheitsminister Matt Hancock öffentlich.
In Deutschland fehlt bis heute jede Entschuldigung. Auch eine umfassende Offenlegung interner Schering-Dokumente lehnt Bayer ab. Dabei wünschen sich viele der mutmaßlich Geschädigten nicht nur Aufklärung, sondern auch Anerkennung ihres Leidens.
Quelle: RBB24